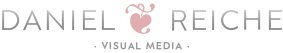Meine ersten Grafikerfahrungen durchlebte ich bei einem regionalen Verlag. Nichts großes. Eine kleine Wochenzeitung, die sich über Anzeigenverkäufe finanzierte. Aber immerhin groß genug, um den Zeitungssatz nicht auszulagern, sondern eine eigene Grafikabteilung zu unterhalten, die die Einzelausgaben aus Textblöcken und Werbeanzeigen zusammenpuzzelte.
Genau dort saß ich nun. Und da bei einer Wochenzeitung das Zusammenbauen der einzelnen Ausgaben nur einmal in der Woche anfiel, blieb für den Rest der Woche das „designen“ der einzelnen Anzeigen. Hier lernte ich schnell was es heißt, eine A4-Seite umfassende Inhalte in eine Form zu quetschen, die kaum größer als eine Kreditkarte war. Gut aussehen sollte es auch noch. Da blieb kaum gestalterischer Freiraum und eher nur der Griff zur Vorschlaghammermethode: alles fett, alles rot und alles groß.
Das verinnerlicht, setzte ich meine Arbeit bei einer großen Tageszeitung fort. Mein damaliger Chef schaute sich das eine Weile an und wandte sich dann mit den einprägsamen Worten zu mir, dass er gestalterische Aufträge kreativ umgesetzt haben möchte und nicht nur einfach erledigt. Eine sehr gute Einstellung, die ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, wenn man mal einen Auftrag schnell runterreißen möchte.
Seitdem ist viel Zeit vergangen. Zeit in der ich als «Gebrauchsgrafiker» (wie mich ein Kollege mal freundlicherweise nannte) so einige Van-Damme-Artistik zwischen Kunst und Kommerz hinlegen musste. Die Überlegungen zur Funktion einer Gestaltungsarbeit wurden für mich zum Ankerpunkt. Das geschieht mittlerweile ganz unbewusst. Zu Lasten der Kreativität geht das selten. Es ist nämlich beileibe keine Kunst, ein Design zu erstellen, das hinreißend aussieht, aber in der Praxis kaum einsetzbar ist.
Ich sehe es vielmehr als eigentlich Kunst an, in einem fest abgesteckten Rahmen (Einsatzort, Größe etc.) mit verfügbaren Mitteln ein frisches Design zu erstellen, dass neben dem Augenzuckereffekt auch den gewünschten Nutzen bringt. Nicht ohne Grund schweben in künstlerischen Gefilden die Worte durch den Raum, dass erst Begrenzung die Quelle der Kreativität sprudeln lässt. Ein Künstler hat seine Leinwand, seine Hausfassade oder seinen Sandsteinblock. Selbst aus der Twitter-Zeichenbegrenzung schlüpfte eine eigene Kunstform.
Zugegeben blicke ich ab und an neidisch auf die Haus-und-Hof-Designer diverser Theater oder Museen. Hier kann sich unkonventionelles Design erlauben, sich über einen längeren Zeitraum in die Köpfe zu brennen, ohne kommerziellem Druck ausgesetzt zu sein. Der künstlerische Anspruch steht hier deutlich vor der eigentlichen Werbefunktion. Bei eingehender Betrachtung sieht man jedoch auch hier an kleinen Details, dass ein gewisser Rahmen vorgegeben war, nach der sich der Gestalter zu richten hatte.
Sei es nach dem Schwerpunkt einer Ausstellung oder schlicht und einfach finanziellen Aspekten. Oft gesehen: Das Monatsprogramm presst sich auf einen unhandlichen und praktisch unbenutzbaren Mega-Leporello (nicht so teuer wie eine Broschüre) oder verwendet Schriften mit geringer Deckkraft, da das gewählte günstige Papier so dünn ist, dass die Kehrseite durchscheint.
Weiter oben sprach ich von einem Spagat. Eigentlich ist es ja keiner zwischen Kunst und Kommerz, sondern vielmehr einer zwischen eigenem Anspruch eines Designs und dessen finalen Verwendungszweck. Je nach Auftragsart gewichtet mal das eine und mal das andere mehr. Ohne einander kommen aber beide nicht aus.
form follows function follows form